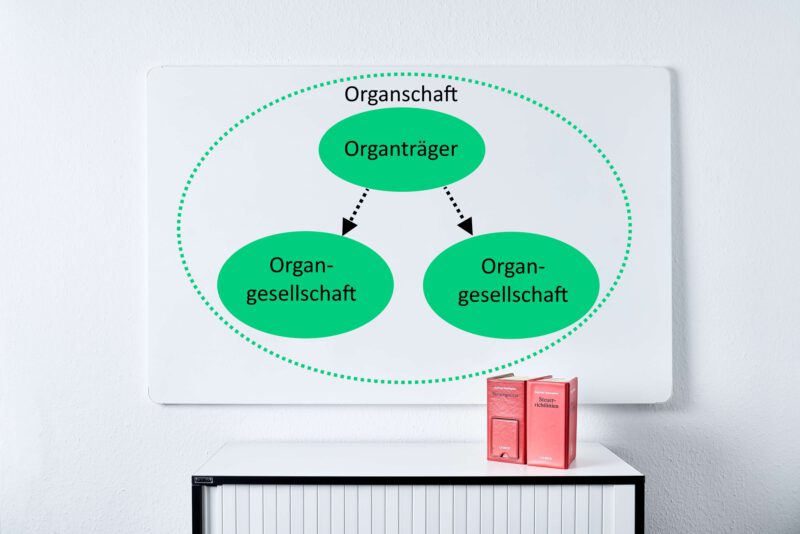Neue EuGH-Entscheidung zum überhöhten Steuerausweis
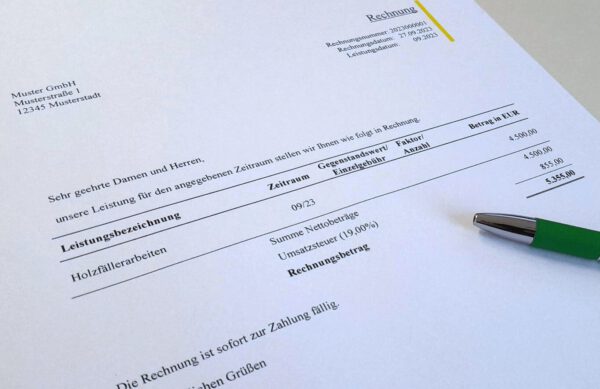
Grundsätzlich gilt für die Umsatzsteuer, dass die Steuer, die auf einer Rechnung offen ausgewiesen ist, auch tatsächlich an das Finanzamt abgeführt werden muss. Man unterscheidet dabei zwischen unrichtig und unberechtigt ausgewiesener Steuer. Unrichtig ist der Steuerausweis, wenn die Höhe der Steuer falsch angegeben ist, also wenn etwa eine Leistung nur dem ermäßigten Steuersatz von 7 % unterliegt, aber dennoch der Regelsteuersatz von 19 % auf der Rechnung ausgewiesen ist. Unberechtigt ist der Steuerausweis, wenn eine Steuer ausgewiesen wird, obwohl dies schon dem Grunde nach falsch ist, also wenn beispielsweise eine Privatperson Umsatzsteuer ausweist.
Bereits mit Urteil vom 08.12.2022 hatte der EuGH entscheiden, dass keine Verpflichtung zum Abführen von unberechtigt ausgewiesener Umsatzsteuer besteht, wenn der Leistungsempfänger keinen Vorsteuerabzug vornehmen kann. Wir hatten bereits damals mit einem Newsbeitrag berichtet. >>Link<<
Auch das BMF hat reagiert und die Entscheidung des EuGH grundsätzlich in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass übernommen, jedoch mit praktischen Einschränkungen versehen.
Zwischenzeitlich war beim BFH ein Verfahren hierzu anhängig, welches inzwischen ohne Urteil erledigt ist.
Der EuGH hat nun mit einem neuen Urteil vom 01.08.2025, C-794/23 weiter zum Thema Stellung genommen.
Es ist für jede einzelne Rechnung gesondert zu beurteilen, ob diese eine Steuerschuld im Sinne des § 14c UStG auslöst. Eine Rechnung an einen Endverbraucher löst keine unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer aus.
Der Begriff „Endverbraucher“ ist dabei eng auszulegen. Darunter fallen ausschließlich Nichtsteuerpflichtige. Steuerpflichtige, die Leistungen im Einzelfall für private oder sonstige nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende Zwecke in Anspruch nehmen, gelten dagegen nicht als Endverbraucher in diesem Sinne. Bei ihnen bestehe die abstrakte Möglichkeit eines Vorsteuerabzugs, was schädlich sei.
In den Fällen, in denen Massengeschäfte vorliegen und man eine einzelfallbezogene Prüfung in der Praxis nicht durchführen kann, wird durch den EuGH ausdrücklich die Möglichkeit der sachgerechten Schätzung zugelassen. Diese Schätzung muss auf objektiven, aktuellen und nachvollziehbaren Daten beruhen und sich an konkreten Anhaltspunkten orientieren, wie etwa der Art der erbrachten Leistung, den Modalitäten ihrer Erbringung, der Art der Rechnungslegung und vorhandenen statistischen Informationen über den Kundenkreis. Der Unternehmer muss die Möglichkeit haben, die Richtigkeit der Schätzung durch das Finanzamt vor Erlass einer belastenden Maßnahme in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu bestreiten und entkräftende Umstände vorzutragen. Das Beweismaß darf dabei nicht übermäßig hoch angesetzt werden.
Damit geht der EuGH grundsätzlich weiter als die Finanzverwaltung in ihrem BMF-Schreiben und dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass. Es ist daher davon auszugehen, dass diesbezüglich das letzte Wort noch nicht gesprochen sein dürfte.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und nehmen Sie bei Fragen gern Kontakt zu uns auf!